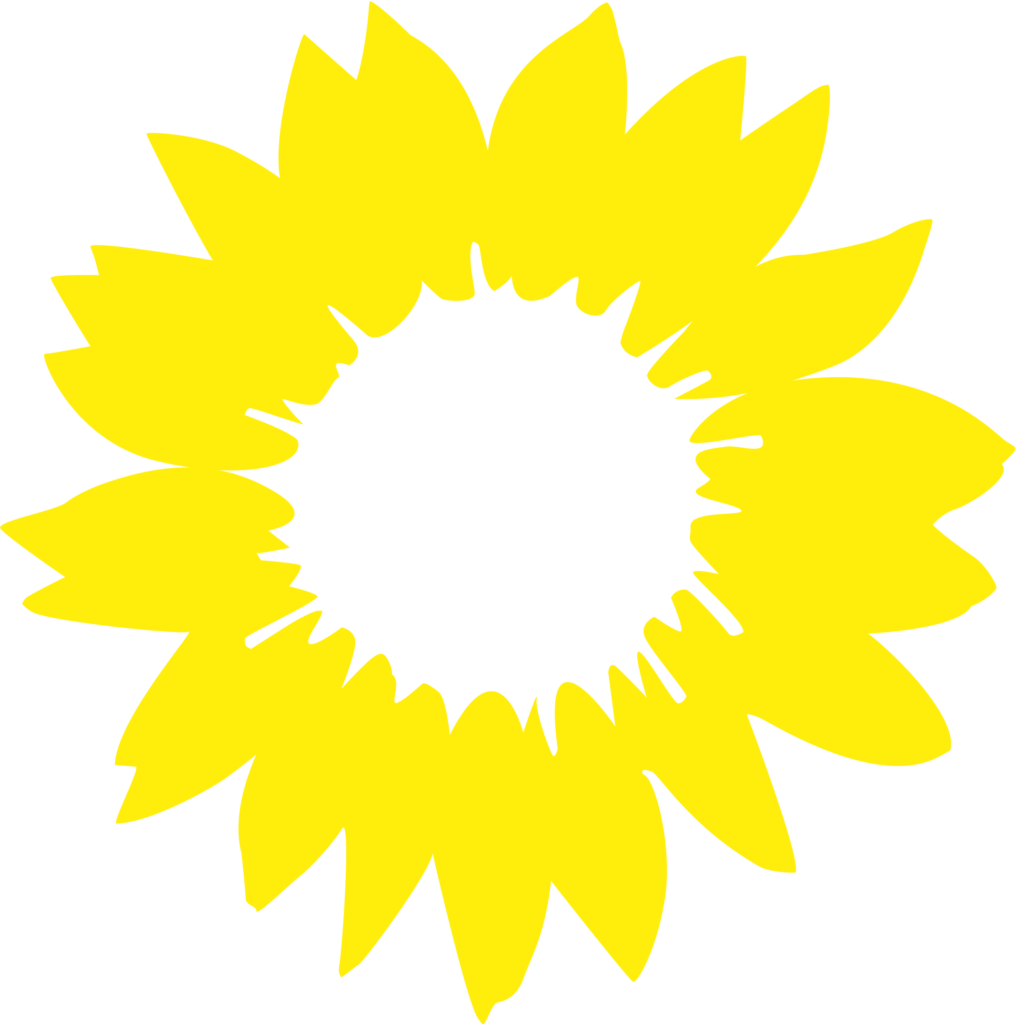Veranstaltung zum Nahverkehr mit Katja Meier, Spitzenkandidatin der Grünen zur Landtagswahl – Bericht der Del. LVZ vom 17.05.2019

…. Mehr Plus-Bus-Linien und neue Haltestellen …. MDV-Chef Steffen Lehmann stellt bei Grünen-Diskussion Nahverkehrsmodell der Leipziger Region vor … Von Kathrin Kabelitz…Bad Düben. Die Diskussion um Klimawandel, Feinstaub und Dieselfahrverbote […]
Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Kandidaten Kommunalwahlen 9.03.2019 10.00 Uhr E-Werk Oschatz
Kreisverband Bündnis 90 / Die Grünen in Nordsachsen Am 09.03.2019 um 10.00 Uhr wird in Oschatz, E-Werk. Lichtstr.1, die Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Kandidaten für die kommunalen Wahlen, die Kreistags -u. Landtagswahlen stattfinden. […]
Presse zum Besuch von Volkmar Zschocke, MdL und u.a. zuständig für Soziales, zum Besuch der Pflegeeinrichtung in Mockrehna
….http://www.lvz.de/Region/Eilenburg/Gruenen-Politiker-auf-Sozialtour-in-Mockrehna …. TZ ….. MOCKREHNA Vom Pflegefall zum Sozialfall von unserem Redakteur Christian Wendt Mockrehna/Dresden. Mit Frühsport hatte dieser verbale Spagat nichts gemein, obgleich der Puls bei Rosel Müller-Süptitz und […]
Dr. Claudia Maicher, MdL im Landkreis Nordsachsen unterwegs – der Bericht

In dieser Woche war ich in Nordsachsen unterwegs, um mich vor Ort über verschiedene Projekte und Einrichtungen zu informieren. Den Anfang machte das Kinderhaus Rackwitz, wo ich das Programm „Kinder […]